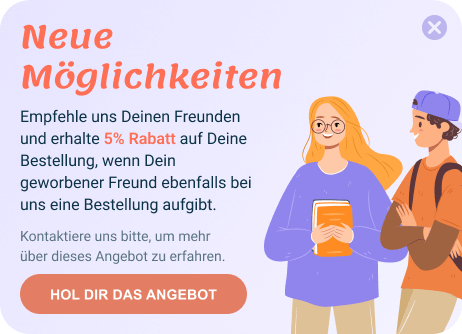Inhaltsverzeichnis
- Empirische oder theoretische Bachelorarbeit? So triffst du die richtige Wahl
- Was ist eine theoretische Bachelorarbeit?
- Typische Merkmale einer theoretischen Bachelorarbeit
- Vorteile:
- Nachteile:
- Was ist eine empirische Bachelorarbeit?
- Typische Methoden:
- Vorteile:
- Nachteile:
- Entscheidungshilfen: Welche Variante passt zu mir?
- 1. Deine Interessen und Stärken
- 2. Verfügbare Ressourcen und Zeitmanagement
- 3. Betreuung und Vorgaben der Hochschule
- 4. Vorerfahrung
- 5. Berufliche Ziele und Weiterentwicklung
- Keine Methode ist per se besser – es kommt auf dich an
Die Wahl zwischen einer empirischen und einer theoretischen Bachelorarbeit ist eine der ersten großen Entscheidungen auf deinem Weg zum langersehnten Abschluss. Aber warum ist das eigentlich so wichtig? Ganz einfach: Dein Ansatz bestimmt, wie du die nächsten Wochen oder Monate verbringen wirst – ob du dich in Bibliotheken vergräbst und Daten erhebst, Fragebögen auswertest oder philosophische Diskurse analysierst.
Aber Vorsicht: Nicht immer hast du vollständige Freiheit. Dein Studienfach spielt nämlich eine große Rolle. In den Naturwissenschaften oder der Psychologie sind empirische Arbeiten oft Standard, während in den Geisteswissenschaften theoretische Analysen in der Regel deutlich häufiger sind. Und auch die Vorgaben deiner Hochschule oder deines Betreuers können die Entscheidung beeinflussen. Manche Professoren bevorzugen klar eine der beiden Methoden oder haben bestimmte Erwartungen. Und nicht zuletzt kommt es natürlich auch auf die Machbarkeit an: Hast du Zugang zu den notwendigen Daten und genug Zeit für aufwändige Erhebungen?
Kurz gesagt: Die Entscheidung zwischen einer empirischen und einer theoretischen Arbeit ist nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern auch der Rahmenbedingungen.
Was ist eine theoretische Bachelorarbeit?
Eine theoretische Bachelorarbeit (auch Literaturarbeit oder konzeptionelle Arbeit genannt) beschäftigt sich vor allem mit bereits existierendem Wissen. Statt selbst Daten zu erheben, analysierst und strukturierst du vorhandene Theorien, Konzepte oder aktuelle Forschungsstände.Typische Merkmale einer theoretischen Bachelorarbeit
- Theorievergleich: Du setzt verschiedene Ansätze miteinander in Beziehung (zum Beispiel „Unterschiede zwischen Freuds und Jungs Psychoanalyse“).
- Begriffsanalyse: Du untersuchst, wie ein Begriff in der Forschung verwendet wird (beispielsweise „Was bedeutet ‚Nachhaltigkeit‘ in der modernen Wirtschaftsliteratur?“).
- Argumentative Auseinandersetzung: Du entwickelst eine eigene Position, indem du Forschungsmeinungen gegenüberstellst und sinnvoll bewertest.
- Strukturierung eines Themas: Du fasst den aktuellen Forschungsstand zusammen und identifizierst Lücken oder Widersprüche.
Vorteile:
- Geringerer organisatorischer Aufwand (keine aufwendige und langwierige Datenerhebung nötig).
- Gut geeignet, wenn du gerne liest, analysierst und Texte strukturierst.
- Weniger abhängig von externen Faktoren (zum Beispiel von Teilnehmern für Umfragen).
Nachteile:
- Kann sehr abstrakt wirken, wenn dir die praktische Anwendung fehlt.
- Es besteht das Risiko, nur eine „Aneinanderreihung von Quellen“ zu produzieren (eigene Argumentation ist demnach sehr wichtig).
Was ist eine empirische Bachelorarbeit?
Bei einer empirischen Bachelorarbeit geht es in der Hauptsache darum, eigene Daten zu erheben und auszuwerten. Das kann eine Umfrage, ein Experiment, Experteninterviews oder auch eine Beobachtungsstudie sein. Wenn die Abschlussarbeit empirisch ist, steckst du deine Nase also nicht nur in die Bücher, sondern sammelst aktiv neue Erkenntnisse.Typische Methoden:
- Quantitative Forschung: Zahlenbasierte Auswertung (beispielsweise Online-Umfragen mit Statistikprogrammen wie SPSS).
- Qualitative Forschung: Tiefgehende Analysen (Leitfadeninterviews oder Fallstudien).
- Experimente: Kontrollierte Versuche (häufig für Naturwissenschaften oder Psychologie).
- Mixed Methods: Eine Kombination aus qualitativen Ansätzen und quantitativen Ansätzen.
Vorteile:
- Praktische Relevanz (du generierst neues Wissen, mit dem du die Forschung voranbringen kannst).
- Gut, wenn du gerne eigenständig forschst und mit Menschen und Daten arbeitest.
- Kann sich grundsätzlich gut für spätere Masterarbeiten oder Jobs eignen.
Nachteile:
- Höherer Aufwand (Recruiting von Teilnehmern, Datenauswertung etc.).
- Abhängigkeit von externen Faktoren (wie zum Beispiel eine schlechte Rücklaufquote bei Umfragen).
- Statistische Kenntnisse werden oft vorausgesetzt (je nach Methode).
Entscheidungshilfen: Welche Variante passt zu mir?
Die Wahl zwischen einer empirischen und theoretischen Bachelorarbeit hängt von mehreren Faktoren ab. Und jetzt die große Frage: Wie entscheidest du dich? Hier ein paar Kriterien, die dir möglicherweise helfen können:1. Deine Interessen und Stärken
- Bist du ein Lese- und Denktyp? Dann empfiehlt sich die theoretische Arbeit.
- Bist du eher praktisch veranlagt und möchtest „etwas Eigenes erschaffen“? Dann könnte die empirische Arbeit genau das Richtige für dich sein.
2. Verfügbare Ressourcen und Zeitmanagement
- Hast du Zugang zu Daten, Laboren, passender Software und Interviewpartnern?
- Wie viel Zeit hast du? Empirische Arbeiten brauchen nämlich oft deutlich mehr Vorlauf.
3. Betreuung und Vorgaben der Hochschule
- Gibt dein Betreuer eine Methode vor? Manche Dozenten bevorzugen klar eine Methode oder haben Expertise in einem bestimmten Bereich (zum Beispiel in der qualitativen Forschung).
- Unterstützt er/sie dich bei der empirischen Auswertung?
4. Vorerfahrung
- Hast du schon mal SPSS genutzt oder Interviews komplett eigenständig geführt?
- Fühlst du dich sicher im wissenschaftlichen Schreiben?
5. Berufliche Ziele und Weiterentwicklung
- Ein Master oder eine Doktorarbeit geplant? Eine empirische Arbeit kann dabei helfen, Methodenkenntnisse zu vertiefen (wichtig für forschungsstarke Studiengänge).
- Praxiserfahrung gefragt? Falls du später in der Marktforschung, im Bereich UX-Design oder in den Sozialwissenschaften arbeiten möchtest, sind empirische Skills oft ein Plus.
- Theorie-affine Berufe: Für Journalismus, Politikberatung oder Philosophie kann eine starke theoretische Analyse ebenfalls wertvoll sein.
Kriterium Theoretische Arbeit Empirische Arbeit
Interesse Literatur, Diskurse Praxis, Datenerhebung
Zeitbedarf Oft kürzer Meist länger
Betreuer-Unterstützung Theoretische Expertise Methoden-Know-how
Daten/Ressourcen Nicht nötig Müssen zwingend verfügbar sein
Berufliche Relevanz Gut für analytische Jobs Gut für Forschungsberufe
Keine Methode ist per se besser – es kommt auf dich an
Ob empirisch oder theoretisch – es gibt kein „richtig“ oder „falsch“. Wichtig ist, dass die gewählte Methode zu deinen Fähigkeiten, Interessen und Rahmenbedingungen passt. Eine gut gemachte theoretische Arbeit kann genauso überzeugen wie eine empirische Studie.Die wichtigsten Erfolgskriterien:
- Eine klar formulierte Forschungsfrage
- Eine möglichst stringente Methodik
- Eigenständige Leistung (egal ob in der Analyse oder der Datenerhebung)
- Und nicht zuletzt Motivation